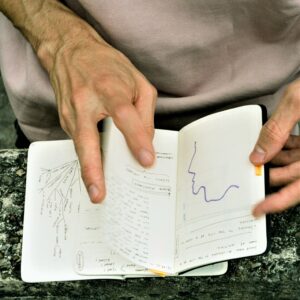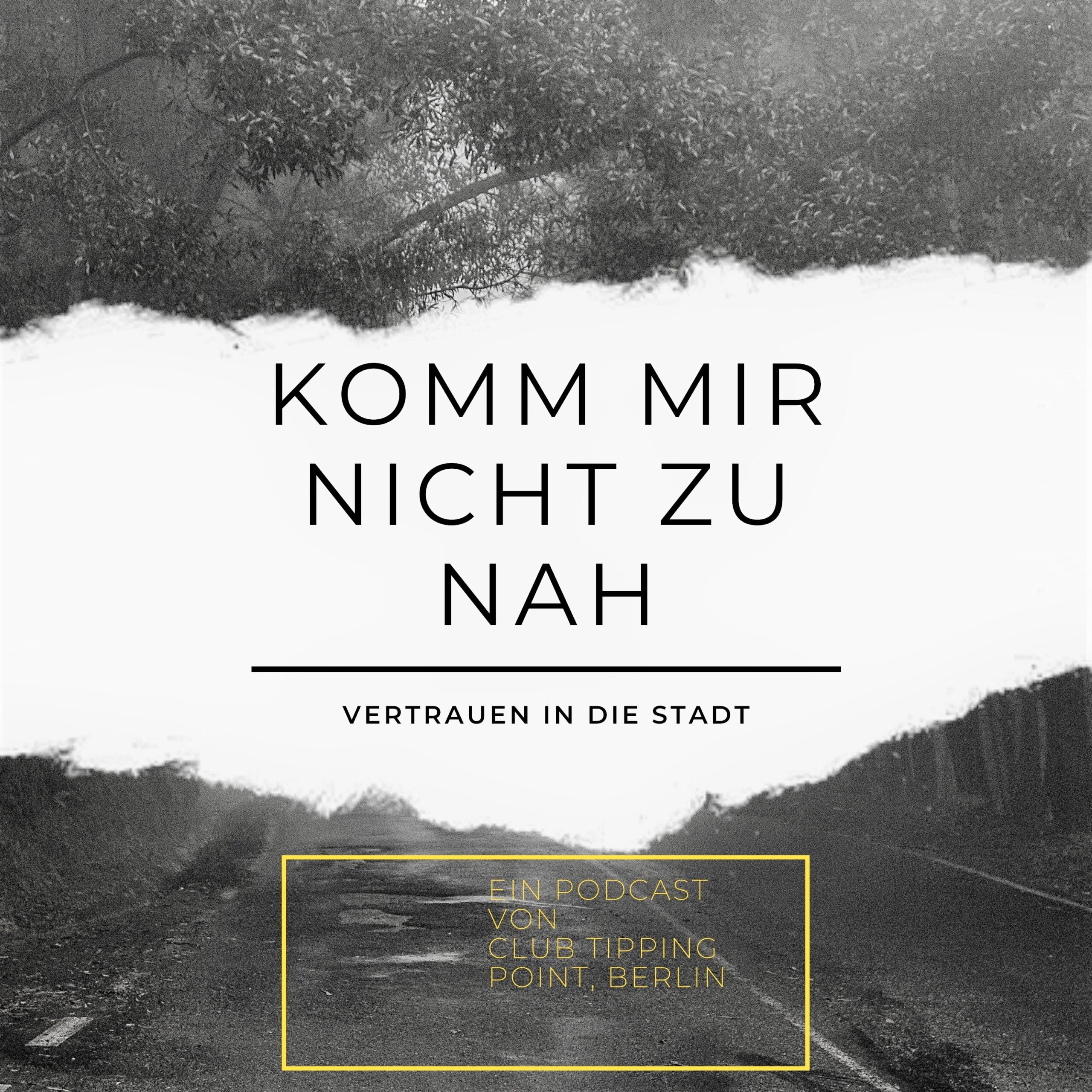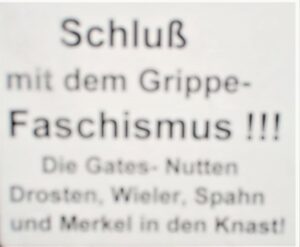Von und mit Maryna Demb und Mykhailo und Valeriia
Eine Produktion von ctp, Berlin
Christoph M. Gosepath und Markus Stein
(Mitarbeit Lisa Eichhorn)
Krieg
Musik heilt Wunden und flickt Abgründe zusammen. Aber niemand kann wiederauferstehen.
Krieg ist nicht wie Poesie.
Krieg ist wie ein Geräusch, das einen zu einem Punkt schrumpfen lässt.
Der Krieg hat alle Organe ausgefüllt und den Lebenswillen gestoppt.
Raus aus meinem Körper.
Verschwinde aus meinem Leben. Ich bin stärker als du. Mein Herz ist stärker als deines. Auch wenn Du selbst kein Herz hast.
Du besitzt nichts außer die Befehle Deines Vorgesetzen.
Weg! Geh zurück zu der Lava, aus der du gemacht bist!
Die Ukraine geht Dich nichts an! Die Ukraine ist ein heiliges Land, in dem die Jungfrau Maria selbst wandelt …
Gesegnete Jungfrau! Unsere liebe Frau! Ich bitte dich, lege einen heiligen Schleier über meinen Krieger.
Beschütze ihn mit der Kuppel unserer Gebete. Schütze ihn vor den Kugeln des Feindes.
Und mache ihn widerstandsfähig gegen das Feuer des Drachens mit einem Schwert des Erzengels in der Hand, mit seinem Schild …
Ich könnte viel für die Ukraine tun, aber ich halte deine Hand, mein Sohn.
Ich könnte ein Netz weben, ein Bild malen. Aber ich halte deine Hand, mein Sohn.
Ich hätte Lebensmittel ausliefern können, ich hätte ihnen den Rücken freihalten können. Ich hätte mich beim Militär melden können.
Ich könnte … Ich könnte … Denn ich fühle mich schuldig, weil ich hilflos bin.
Das hätte ich tun können, aber ich halte deine Hand, mein Sohn.
Oh Gott! Wenn die Menschen wüssten, wie schwer es für diese Welt ist, neue Männer zu gebären, würden sie keine Kriege anfangen!
Ich bin nur eine Frau.
Ich bin nur eine Frau.
Fünf Buchstaben in einem Wort, kann es einfacher sein?
Ich bin zärtlich, ich bin geliebt, ich bin Dein. Ich bin diejenige, die am meisten auf der Welt geliebt wird. Im Schmerz gebe ich Leben.
Mit zusammengebissenen Zähnen lasse ich dich in den Krieg ziehen.
Ich stehe am Fenster und schaue ungläubig
Ich bin einfach nur eine Frau. Und diese Einfachheit kennt kein Ende.
Textkomposition von
Maryna Demb
Lita Akhmetova
Tetyana Valigurska
Sofiia Krymovska